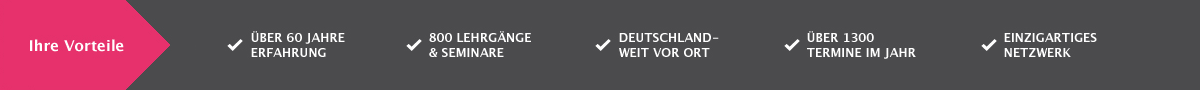CE-Kennzeichnung von Medizinprodukten: Voraussetzung für den Marktzugang in Europa

Ein kleines Zeichen mit großer Wirkung – auch für Medizinprodukte: Die CE-Kennzeichnung entscheidet darüber, ob sie den Weg in Krankenhäuser, Arztpraxen oder Apotheken findet – oder eben nicht. Sie ist auch für viele andere Produkte der Schlüssel zum europäischen Markt, das sichtbare Signal, dass Sicherheit und Leistung überprüft und bestätigt wurden. Für Hersteller und Zulieferer ist sie damit weit mehr als ein formaler Schritt. Sie ist einerseits eine unverzichtbare Eintrittskarte in den Markt – und andererseits ein Versprechen an Patientinnen und Patienten.
Was steckt hinter der CE-Kennzeichnung?

Abb. 1.: Das korrekte Schriftbild des CE-Zeichens. Die Proportionen der Zeichen sind exakt festgelegt und müssen bei jeder Verwendung eingehalten werden. Veränderungen der Form oder das Verzerren sind nicht zulässig (©Adobe Stock)
Das CE-Zeichen wirkt unscheinbar. Doch hinter den beiden Buchstaben verbirgt sich ein komplexes Geflecht aus Regeln, Prüfungen und Nachweisen. Es ist kein Qualitätssiegel im klassischen Sinn, sondern eine rechtlich bindende Erklärung des Herstellers, dass sein Produkt die europäischen Vorgaben erfüllt. Ohne CE-Kennzeichnung ist ein Medizinprodukt in Europa schlicht nicht verkehrsfähig.
Der rechtliche Rahmen: Die MDR
Seit Mai 2021 bildet die Medical Device Regulation (MDR) den verbindlichen Rechtsrahmen für die CE-Kennzeichnung von Medizinprodukten in Europa. Sie regelt,
- welche Anforderungen ein Produkt erfüllen muss,
- wie Hersteller die Konformität nachweisen,
- welche Rolle unabhängige Prüfstellen spielen,
- und wie Produkte auch nach dem Inverkehrbringen überwacht werden.
Eine zentrale Rolle nehmen dabei die Benannten Stellen ein. Sie sind von den Behörden autorisierte, unabhängige Prüf- und Zertifizierungsorganisationen, die für Medizinprodukte der höheren Risikoklassen bewerten, ob die Anforderungen der MDR erfüllt sind.
Auch die Klassifizierung der Produkte nach Risikoklassen ist für die CE-Kennzeichnung entscheidend:
- Klasse I: geringes Risiko – etwa nicht sterile Verbandsmaterialien wie Pflaster oder Kompressen
- Klasse IIa/IIb: mittleres Risiko – zum Beispiel Ultraschallgeräte für die Diagnose (IIa) oder Infusionspumpen (IIb)
- Klasse III: hohes Risiko – wie Herzschrittmacher oder andere implantierbare Produkte, die unmittelbar lebenswichtige Funktionen beeinflussen
Während Hersteller Produkte der Klasse I meist eigenständig bewerten dürfen, ist bei höheren Risikoklassen zwingend eine Benannte Stelle einzubeziehen. Je höher die Risikoklasse, desto aufwendiger das Verfahren – und desto anspruchsvoller der Weg zum CE-Zeichen.
Das Qualitätsmanagementsystem als Fundament
Die MDR verpflichtet die Hersteller von Medizinprodukten, ein Qualitätsmanagementsystem (QMS) aufzubauen, um die Einhaltung der MDR auf wirksame und angemessene Weise zu gewährleisten. Es umfasst alle Teile und Elemente der Organisation eines Herstellers, die mit der Qualität der Prozesse, Verfahren und Produkte befasst sind und sorgt dafür, dass die regulatorischen Anforderungen konsequent umgesetzt werden. Es bildet zudem das organisatorische Rückgrat der CE-Kennzeichnung:
- Es regelt, wie Prozesse geplant, dokumentiert und überprüft werden.
- Es stellt sicher, dass normative und regulatorische Anforderungen in der täglichen Praxis umgesetzt werden.
- Es sorgt dafür, dass Daten aus Entwicklung, Produktion und Marktüberwachung konsistent zusammenfließen.
Ohne QMS sind die geforderten Nachweise und benötigte Unternehmensleistung kaum zu erbringen. Insbesondere bei Produkten der Klassen II und III ist ein zertifiziertes QMS daher Pflicht und eine Grundvoraussetzung für die Zusammenarbeit mit Benannten Stellen.
Der Weg zum CE-Zeichen
Die CE-Kennzeichnung ist das Ergebnis eines klar definierten, mehrstufigen Ablaufs, dessen Umfang und Anforderungen maßgeblich von Faktoren wie Produkttyp, Risikoklasse und gewähltem Konformitätsbewertungsverfahren abhängen. Typische Phasen sind die folgenden:
Phase 1: Definition der Zweckbestimmung und Klassifizierung des Produkts
Die CE-Kennzeichnung beginnt mit der Festlegung der Zweckbestimmung, auf deren Grundlage die Risikoklasse nach MDR Anhang VIII bestimmt wird – sie entscheidet maßgeblich über das weitere Verfahren.
Phase 2: Ermittlung und Umsetzung der regulatorischen Anforderungen
Der Hersteller identifiziert geltende Anforderungen aus der MDR sowie anwendbare Normen und setzt diese systematisch um.
Phase 3: Erstellung der Technischen Dokumentation
Die Technische Dokumentation enthält alle Nachweise zur Sicherheit, Leistung und Konformität, einschließlich Risikoanalyse, klinischer Bewertung, Gebrauchsanweisung und Etikettierung.
Phase 4: Durchführung des Konformitätsbewertungsverfahrens
Das Konformitätsbewertungsverfahren ist der formale Weg zur CE-Kennzeichnung; abhängig von der Risikoklasse erfolgt es entweder durch Eigenbewertung oder unter Einbeziehung einer Benannten Stelle.
Phase 5: Prüfung durch Benannte Stelle (sofern erforderlich)
Für Produkte der Klassen IIa, IIb und III prüft eine Benannte Stelle je nach gewähltem Konformitätsbewertungsverfahren das Qualitätsmanagementsystem, die Technische Dokumentation oder beides, bevor der Hersteller die Konformitätserklärung ausstellen darf.
Phase 6: Ausstellung der Konformitätserklärung und Anbringung des CE-Zeichens
Nach erfolgreichem Verfahren stellt der Hersteller die EU-Konformitätserklärung aus und bringt das CE-Zeichen an – bei Einbindung einer Benannten Stelle unter Angabe ihrer Kennnummer.
Mit der CE-Kennzeichnung endet der Prozess jedoch nicht: Durch Vigilanz, Post-Market Surveillance und Änderungsmanagement muss der Hersteller auch nach dem Inverkehrbringen sicherstellen, dass das Produkt dauerhaft die regulatorischen Anforderungen erfüllt. Die CE-Kennzeichnung ist damit kein einmaliger Stempel, sondern das Ergebnis kontinuierlicher, systematischer Bemühungen um Qualität und Sicherheit, die den gesamten Lebenszyklus eines Produkts begleiten.
Herausforderungen in der Praxis
Die Realität zeigt: Der Weg zum CE-Zeichen ist für viele Unternehmen ein Kraftakt. Engpässe bei Benannten Stellen, hohe Anforderungen an klinische Daten und eine umfangreiche Dokumentationslast machen das Verfahren langwierig und ressourcenintensiv. Viele Unternehmen berichten, dass gerade die klinische Bewertung einen großen Zeit- und Kostenfaktor darstellt.
Hinzu kommt, dass verschiedene Fachbereiche – Qualitätsmanagement, Regulatory Affairs und Entwicklung – eng zusammenarbeiten müssen. Erst dieses Zusammenspiel ergibt ein vollständiges Bild.
Besonders kleine und mittelständische Hersteller stoßen hier an Grenzen. Gleichzeitig zeigt sich: Wer ein stabiles QMS etabliert, interne Abstimmungen und Zusammenarbeit effizient gestaltet und Expertise aufbaut, verschafft sich einen entscheidenden Vorteil.